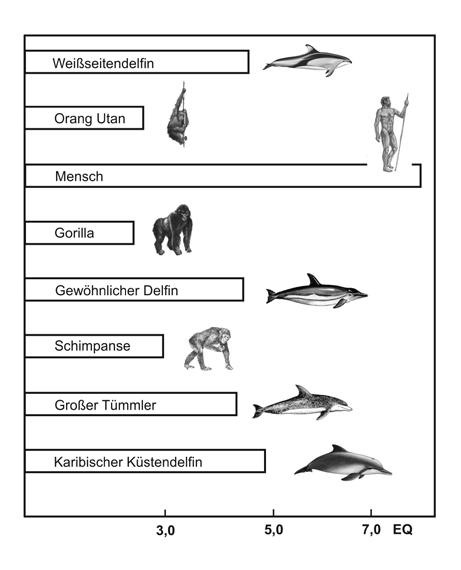|
| zur Übersicht |
Merkblatt-
Beilage 35: |
| Die Biologie der Freiheit |
| Zur Entstehung von Autonomie in der Evolution |
| |
| Bernd Rosslenbroich |
| |
| Kann es sein, dass der Mensch schon durch
seine biologische Organisation auf die Fähigkeit zur Freiheit ausgerichtet
ist? Dieser Frage geht Bernd Rosslenbroich, Evolutionsbiologe an der Universität
Witten/Herdecke, nach und entdeckt dabei einen Trend zu immer mehr Autonomie
in der organischen Evolution bis hin zum Menschen. Besonders eindrücklich
zeigt sich dieser Trend in der Entstehung der Möglichkeit zum freien
Spiel bei Säugetieren und Vögeln. Seine »Krönung«
findet er in den biologischen Voraussetzungen für die Ausbildung der
kulturellen Fähigkeiten des Menschen. Rosslenbroich kommt zu dem Schluss,
dass unsere Natur nicht determinierend, sondern ermöglichend ist. –
In einem Ausblick knüpft er die Biologie der Freiheit an die »Philosophie
der Freiheit« Rudolf Steiners an. |
| |
| 1
Die Frage nach der Freiheit beschäftigt den Menschen schon lange. Sie
lässt sich bis weit in die Geschichte von Philosophie und Naturwissenschaft
zurückverfolgen. Dabei wird der Begriff Freiheit sehr unterschiedlich
gebraucht. So kann Freiheit verstanden werden als die Möglichkeit zur
Selbstbestimmung unabhängig vom Willen eines Anderen. Oder auch als
Möglichkeit, bestimmte Handlungen aus einem Spektrum von Optionen seinem
eigenen Wunsch gemäß umsetzen zu können. In wieder anderem
Sinne besteht Freiheit darin, dass wir unseren eigenen Willen selbständig
formen und dass wir bei dieser Herausbildung unseres eigenen Willens nicht
festgelegt sind. |
| In den letzten Jahren hat in Deutschland eine
umfangreiche Debatte stattgefunden, in der es insbesondere um die sogenannte
Willensfreiheit ging. Die Frage war, ob unser handlungsleitender Wille und
unsere Entscheidungsfähigkeit durch bestimmte organische Prozesse festgelegt
ist oder ob wir unser Handeln weitgehend unabhängig und selbstgeführt
bestimmen können. Herausgefordert wurde die Debatte durch Stellungnahmen
einiger Neurowissenschaftler zu Forschungsergebnissen, die eine naturgesetzliche
Determiniertheit des Verhaltens belegen sollen. Die molekularen Funktionen
der Neurone würden letztlich unser Verhalten leiten und lediglich die
Illusion eines freien Willens hervorbringen. Dem traten vor allem Philosophen
vehement entgegen und argumentierten umfangreich für eine selbstverständlich
dem Menschen zukommende Freiheitsfähigkeit.¹ Obwohl viele Naturwissenschaftler
durchaus nicht so einseitige Schlüsse zogen wie etwa Gerhard Roth (2001,
2003) und Wolf Singer (2003) und feststellten, dass auch die neueren Einsichten
der Biologie durchaus nicht der Möglichkeit einer Freiheitsfähigkeit
widersprechen,² schienen die Fronten dieser auch in den Feuilletons
der großen Zeitungen geführten Debatte einigermaßen klar
zu verlaufen: Die Naturwissenschaftler gehen aufgrund der biologischen Organisation
des Menschen eher von einer Determiniertheit seines Handelns aus, während
es mehr in die Domäne der Philosophen fiel, die Freiheitsfähigkeit
des Menschen zu verteidigen. |
¹ Z. B. Geyer 2004, Janich 2008, Nida-Rümelin
2005; vgl. das alphabetische Literaturverzeichnis am Schluss
des Artikels.
² Z.B. Neuweiler 2008, Heilinger 2007, Damasio 2010, Fuchs 2009, Scheurle
2007, Thompson 2007. |
| Ein anderes großes Feld der Diskussion
um die Freiheitsfähigkeit ist die Frage nach dem genetischen Determinismus.
Nach Ansicht vieler Naturwissenschaftler ist der Mensch in seinen Eigenschaften
durch seine genetische Veranlagung festgelegt. Dem ist oft widersprochen
worden, sowohl von philosophischer als auch von naturwissenschaftlicher
Seite.³ Dennoch hat sich diese Auffassung sehr weit durchgesetzt und
beeinflusst das Lebensgefühl der Bevölkerung in der westlichen
Welt. Obwohl gerade die neuesten Erkenntnisse der Genetik selbst zeigen,
dass diese Annahme unhaltbar ist,⁴ hält sie sich hartnäckig
und es werden nach wie vor umfangreiche Forschungsprogramme darauf aufgebaut. |
³ Lewontin et al. 1988, 1991, 2002, Holdrege
1999, Strohman 1998, 2001, 2002, Wieser 1998.
⁴ Bauer 2008, Jablonka 2005, Spork 2009. |
| Auch aus der Evolutionsforschung wird versucht,
eine Festlegung des Menschen herzuleiten. Die Muster unseres Verhaltens
hätten sich aufgrund der Selektionsfaktoren während der Eiszeit
entwickelt. Einzelne »Module«, die man postuliert, hätten
sich im Konkurrenzkampf bewährt und bestimmten noch heute große
Teile unseres Verhaltens. Daher seien wir alle »Fitnessmaximierer«.[a]
Populäre Bücher mit Titeln wie »Mammutjäger in der
Metro« verbreiten diese Behauptungen der Evolutionären Psychologie
in der Bevölkerung. Sie verschweigen dabei aber, dass diese These auch
innerhalb der Naturwissenschaft hoch umstritten ist. |
| Hier sei nur kurz angemerkt, wie sehr viele
der beteiligten Autoren aus ihrer jeweiligen Perspektive heraus argumentieren.
Manche der Naturwissenschaftler scheinen die Ideengeschichte dieser Debatten
nicht zu kennen, die bis ins alte Griechenland zurückreicht. Außerdem
bemerken sie nicht, dass sie eine bestimmte Weltsicht voraussetzen, die
in methodischer Hinsicht zwar für ihre Wissenschaft einen Wert haben
kann, aber nicht ohne Weiteres auf das gesamte Verständnis von Natur
und Mensch anwendbar ist. Auf der anderen Seite scheinen viele Philosophen
die naturwissenschaftlichen Fakten nicht genügend zu kennen, sonst
wären sie in der Lage, den Naturwissenschaftlern nachzuweisen, dass
es gar nicht ihre experimentell erhobenen Daten sind, sondern deren Interpretationen,[b]
die zu einer Kollision mit dem Selbstverständnis des Menschen führt.
So kommen auch Naturwissenschaftler selbst zu ganz unterschiedlichen Aussagen
hinsichtlich der Möglichkeit der Freiheit und berufen sich doch auf
den gleichen Fundus an Forschungsergebnissen.⁵ |
⁵ Eine bemerkenswerte Ausnahme von diesen
verbreiteten Einseitigkeiten ist das kürzlich erschienene, sehr
lesenswerte und gut lesbare Buch von Brigitte Falkenburg (2012) zur Neurobiologie. |
| Ich werde im Folgenden nicht die Argumente
aus diesen Debatten diskutieren, so reizvoll dies wäre. Vielmehr will
ich der Frage nachgehen, ob sich eine Brücke zwischen diesen Gegensätzen
schlagen lässt. Gibt es aus der Biologie Hinweise auf die Möglichkeit
der Freiheit, und wie könnte diese entstanden sein? Kurz gesagt: Gibt
es eine Naturgeschichte der Freiheit? |
| nach oben |
| 2 Muster der Evolution |
| Werfen wir dazu einen Blick in die Evolutionsforschung.
In den herkömmlichen Rekonstruktionen der Evolution gibt es bislang
keine zuverlässige Aussage darüber, was sich denn nun qualitativ
im Laufe der Evolution herausbildete. Es ließ sich zwar zeigen, dass
Bakterien als Erste fossil erscheinen und dass sich dann Zellen mit echtem
Zellkern entwickelten, die sich dann wiederum zu mehrzelligen Formen zusammenfanden.
Daraus entwickelten sich Pflanzen, Pilze und Tiere, unter denen es dann
später auch Säugetiere und Vögel gab. |
| Aber was charakterisiert diese immensen Entwicklungen
eigentlich? Im Anschluss an die Theorie Darwins hatte man zunächst
erwartet, dass es zu einer Zunahme der Überlebensfähigkeit und
einer immer besseren Anpassung gekommen sein müsste. Aber das ist nicht
der Fall: Viele evolutiv ursprüngliche Organismen haben eine hohe Überlebensfähigkeit,
und angepasst ist letztlich jeder Organismus. Eine generelle Veränderung
darin gibt es nicht, auch wenn Anpassungsvorgänge auf den verschiedenen
Stufen jeweils eine Bedeutung haben. In anderen Überlegungen wird angenommen,
dass Organismen immer komplexer oder differenzierter geworden seien. Es
gibt aber viele Beispiele, bei denen Komplexität eher abnimmt.⁶ |
| ⁶ Eine ausführliche Diskussion
dieses Problems findet sich in Rosslenbroich 2002, 2006b. |
| Das Thema ist nicht trivial. Es geht, pointiert
gesagt, um die Bestimmung des Unterschieds zwischen einem Bakterium und
einem Säugetier und derjenigen Prozesse, die sich dazwischen evolutiv
abgespielt haben. Die Synthetische Theorie der Evolution, die in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierte, hat diese qualitative Frage
geradezu unterdrückt: Evolution sei nichts anderes als Zunahme der
Vielfalt. Eine generelle qualitative Veränderung gäbe es nicht,
es käme nur zu verschiedenen Formen der Anpassung. Ob es sich dabei
um die Organisation eines Schwammes oder eines Schimpansen handelt sei unerheblich.
Es wäre also die Frage zu stellen, ob man Muster, »patterns«,
also qualitative Veränderungen in der Grundorganisation der verschiedenen
Gruppen auffinden kann, die in den größeren evolutiven Übergängen
entstanden sind. Gibt es bestimmte Trends in der Evolution? |
| nach oben |
| 3 Veränderungen der Autonomie |
| Schon zu Darwins Zeiten ist gelegentlich die
Vermutung geäußert worden, dass im Laufe der Evolution Organismen
entstünden, die immer autonomer würden und sich von den Umweltbedingungen
emanzipierten. Wenn man diese Vermutung aufgreift und ihr in den biologischen
Daten im Einzelnen nachgeht, zeigt sich, dass in der Evolution schon von
den ersten Anfängen an und dann weiter in allen größeren
Übergängen Grundelemente der Entstehung einer biologischen Autonomie
von Organismen beschreibbar sind. Es kam im Laufe der Höherentwicklung
zu einer größeren Eigenbestimmtheit und damit auch zur Ausbildung
eines dynamischen Gleichgewichtszustandes (Homöostase), der eine erweiterte
Flexibilität gegenüber der Umwelt ermöglicht. Diese Autonomiezunahme
bildet Freiheitsgrade, die in der menschlichen Organisation kulminieren.⁷ |
| ⁷ Rosslenbroich 2006a, 2007, 2009, 2012. |
| Es gibt ein ganzes Arsenal von Ressourcen,
mit denen Organismen diese Autonomie aufgebaut haben. Dazu gehören
äußere Abgrenzungen gegenüber der Umwelt wie die unterschiedlichsten
Hautbildungen und die Entstehung von Schalen, Federn oder Fell. Dazu gehört
die Entwicklung stabiler Blutkreisläufe, so dass Landtiere das Flüssigkeitsmilieu
der Zellen auch unabhängig vom Wasser in der Umgebung aufrecht halten
können. Dazu gehören die vielfältigen Funktionen der Homöostase,
durch die Organismen stabiler werden gegenüber Schwankungen von Umgebungseinflüssen
und die immer umfangreicheren und vielfältigeren Bewegungsmöglichkeiten
der Tiere. Nervensysteme wurden immer besser in der Lage, flexibler und
eigenständiger gegenüber Reizen aus der Umgebung zu agieren. Infolgedessen
wurde auch das Verhalten immer flexibler, bis dahin, dass gewisse Freiheitsgrade
entstanden. Dazu gehört etwa das umfangreiche Lernverhalten bei Schimpansen
oder bei den intelligenten Rabenvögeln und Papageien,[c]
ebenso wie das Spiel der Tiere. |
 |
| Nun ist es wichtig zu betonen, dass diese
Autonomiezunahme in der Evolution keiner linearen Reihenfolge entspricht.
Vielmehr gab es immer eine große Bandbreite von Veränderungen,
die zu ganz verschiedenen Kombinationen von Merkmalen der Autonomie führten.
Sie konnten aber auch Zurücknahmen und Verlust von Autonomie enthalten.
Erst langfristig ergaben sich dann Kombinationen, die eine evolutive Zukunft
in dem Sinne hatten, dass sie die Potenz zu weiteren Emanzipationsschritten
enthielten. |
| Gleichzeitig entstanden allerdings auch Anpassungen
an die Umwelt. Sie sind eine der Voraussetzungen für das Überleben
der Organismen. Letztlich bringt die Evolution offenbar differenzierte Kombinationen
von Autonomiemerkmalen und Anpassungen hervor, was in obiger Abbildung am
Beispiel des Delfins erläutert wird. |
| Dies alles führte dazu, dass die Evolution
sehr komplizierte Wege ging. Sie vollzog sich offensichtlich nicht als Auswicklung
irgendeines vorgegeben Planes (wie es das Wort »evolvere« =
auswickeln nahelegt), sondern war zu jeder Zeit voller Entwicklungsdramatik.[d] |
| nach oben |
| 4 Das Spiel bei Tieren |
| Die Möglichkeiten von Flexibilität
und Unabhängigkeit, wie sie unter den höheren Tieren bereits erreicht
werden, drücken sich in einer besonderen Weise im Spiel der Tiere aus.
Es ist heute klar, dass einige Vögel und die meisten Säugetiere
tatsächlich spielen (Burghardt 2005). Aber es bereitet nach wie vor
Schwierigkeiten zu zeigen, welche Funktion das Spielverhalten bei Tieren
hat. Die Annahme, dass Jungtiere damit Verhaltensweisen einüben und
trainieren, die sie später benötigen werden, mag zwar zutreffen,
erklärt aber nicht die evolutive Entstehung des Spiels. Denn warum
ist ein solches Verhalten nicht gleich angeboren, um zuverlässig abzulaufen,
sobald es vom erwachsenen Tier benötigt wird – so wie es bei den
nicht spielenden Wirbeltieren wie etwa den Amphibien oder den Reptilien
der Fall ist? |
| Unter Spielverhalten kann man jede Bewegung,
Objektmanipulation und soziale Interaktion verstehen, die außerhalb
des Zusammenhangs mit einem aktuellen Problem ausgeführt wird. Spiel
ist ein Verhalten, das von unmittelbaren Bedürfnissen und Anforderungen
entkoppelt ist und innerhalb dieser Eigenständigkeit ein hohes Maß
an Flexibilität enthält. Insofern weist es Freiheitsgrade auf,
die Teil der Autonomie der höheren Tiere sind. |
| Während des Spiels werden Bewegungen
neu »erfunden« oder es treten Verhaltensweisen bzw. Bruchstücke
davon auf, die in anderen Zusammenhängen von Bedeutung sein können,
z.B. Flucht-, Angriffs- oder Beutefanghandlungen. Aber im Spiel sind sie
frei und vielfältig kombinierbar. Sie können individuell geprägt
und damit sehr verschieden sein. Viele Säugetiere führen im Spiel
hochkomplexe Bewegungen aus. |
| Bei vielen Tierarten ist Spielverhalten auf
Jungtiere beschränkt, bei anderen kann es auch im Erwachsenenalter
erhalten bleiben. Das gilt vor allem für Raubtiere, Nager, Primaten
und Wale. Namentlich bei erwachsenen Delfinen ist noch ein erstaunliches
Spielverhalten zu beobachten. Unter Vögeln ist es vor allem bei Rabenartigen,
aber auch bei vielen Papageien [c]
stärker ausgebildet. |
| Auch der Vogelgesang ist teilweise Spiel,
wie Walter Streffer (2009) in seinem wunderbaren Buch über Motive der
Autonomie im Gesang der Vögel überzeugend dargelegt hat. Ausgehend
von der eigenständigen musikalischen Qualität des Vogelgesangs
zeigt er, dass die übliche Interpretation als Reviermarkierung mit
Anpassungsfunktion sehr einseitig ist und ein tieferes Verständnis
des Phänomens verhindert. Das Singverhalten hängt nur in bestimmten
Situationen mit biologischen Notwendigkeiten des Lebenserhalts zusammen.
Je nach Art emanzipiert sich ein kleinerer oder größerer Teil
des Gesangs von solchen Beschränkungen und der Vogel bildet eine erstaunlich
hohe Flexibilität im Umgang mit seinen stimmlichen Möglichkeiten
aus. Während Säugetiere ihr Spiel über Körperbewegungen
ausführen, zelebrieren viele Singvögel ihre Flexibilität
über ihre Stimme. |
| Die Zeit, in der die Jungen von Vögeln
und Säugetieren von den Eltern behütet werden, ist ein Freiraum,
in dem die Jungtiere spielen können. Währenddessen sind sie für
eine mehr oder weniger lange Lernphase relativ unabhängig von überlebensnotwendigen
Tätigkeiten. Jungtiere von Reptilien dagegen verhalten sich von Anfang
an annähernd wie Erwachsene im Miniaturformat. |
| Es kommt aber auch noch eine mentale Form
der Flexibilität hinzu: Spiel beinhaltet Verhaltensweisen, die zum
Schein ausgeführt werden, wie z. B. bei Scheinkämpfen. Die Tiere
müssen also in der Lage sein, ein Verhalten vorzugeben bzw. das Vorgeben
eines Verhaltens bei einem Spielpartner zu erkennen. |
| Solche Scheinhandlungen prägen insbesondere
das Spiel der Menschenkinder. Diese Fähigkeit bildet sich etwa im Alter
von zwei Jahren und wird dann in aller Ausführlichkeit über viele
Jahre betrieben. Eine Voraussetzung dafür ist die Entkopplung zweier
beteiligter Repräsentationen im Bewusstsein: Bei Objekten gibt es zum
einen die wirklichkeitsgemäße Repräsentation des Objektes,
zum anderen eine vorgestellte Version desselben Objektes (die Badewanne
als »Schiff«; der »Kuchen« im Sandkasten). Oder
in Bezug auf Tätigkeiten einmal das wirklichkeitsgemäße
Erleben von sich selbst und zum anderen von der gespielten Handlung, die
deutlich als »nur gespielt« erlebt wird. Diese Entkopplung ist
bereits eine hohe Bewußtseinsleistung und steht am Ursprung eines
seiner selbst bewussten Innenlebens. Insofern spielende Tiere Scheinhandlungen
ausführen können, muss davon ausgegangen werden, dass auch ihnen
bereits eine gewisse, rudimentäre Entkopplung dieser beiden Repräsentationen
zur Verfügung steht. |
| Außerdem wird auch bei Tieren regelmäßig
beobachtet, dass Spielpartner, die gegenüber dem anderen überlegen
oder dominant sind, sich zurückhalten (»self-handicapping«),
wie um das Spiel »fair« zu machen. Dies alles setzt einen gewissen
Grad kognitiver Fähigkeiten voraus und dürfte insofern mit der
Leistungsfähigkeit des Zentralnervensystems in Verbindung stehen. Typisch
für das Spiel ist, dass es im sogenannten »entspannten Feld«
stattfindet, d. h. es wird dann gespielt, wenn keine Gefahr zu befürchten
und keine Bedürfnisse zu decken sind. Diese Unabhängigkeit von
»instinktiven Nötigungen« wird auch als Voraussetzung für
die Entkopplung fixierter Handlungsabläufe gesehen. |
| Spiel ist ein Verhalten, das in einer besonderen
Weise das freudige Interesse des Menschen erregt. Wer hat sich nicht schon
einmal vom ausgelassenen Spiel junger Katzen oder Hunde bezaubern lassen?
Mit vielen Haustieren wird gespielt, und miteinander spielende Tiere zu
beobachten, ist für uns immer ein ästhetisches Erlebnis. Das Spielverhalten
von Tieren rührt uns deshalb so an, weil es Anklänge an die umfangreiche
menschliche Verhaltensflexibilität hat. Irenäus Eibl-Eibesfeldt
(1999) schrieb: »Dadurch, dass im Spiel die Handlungen von den ihnen
normalerweise vorgesetzten Instanzen (Antrieben) abgehängt werden können,
schafft sich das Tier ein entspanntes Feld, und es versetzt sich in die
Lage, mit seinem Bewegungskönnen zu experimentieren und sich dialogisch
mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Diese Fähigkeit, sich distanzieren
zu können, steht an der Wurzel dessen, was wir als spezifische menschliche
Handlungsfreiheit erleben« (S. 416). |
| nach oben |
| 5 Die biologische Autonomie
des Menschen |
| Wie steht nun die biologische Organisation
des Menschen dazu? Der Mensch hat zwar nicht den autonomsten Organismus.
Aber wir haben eine spezielle Kombination von Autonomiemerkmalen, die die
Voraussetzung für hochflexible Handlungsweisen bildet und eine schier
unendliche Vielfalt an Tätigkeiten ermöglicht. |
| Einige dieser Merkmale teilen wir mit unseren
nächsten Verwandten, den Säugetieren. Dazu gehört etwa die
Haut, die in einer geradezu genialen Kombination einen effektiven Umweltabschluss
mit dem Schutz vor Flüssigkeitsverlusten gewährleistet, gleichzeitig
aber auch eine hohe Beweglichkeit zulässt, indem sie flexibel und leicht
ist. Die Hautbildungen in großen Teilen der übrigen Tierwelt
neigen entweder dazu, wenig Umweltabschluss zu gewährleisten oder umfangreiche
Substanzeinlagerungen zu bilden, was zwar eine effektive Abgrenzung ermöglicht,
die Grenzschicht aber oft schwer und steif macht. |
| Die Eigenwärme, die wir mit den Säugetieren
und den Vögeln teilen, führt nicht nur zur Konstanz der Körpertemperatur,
die uns zu einem erheblichen Teil von den Temperaturschwankungen der Umgebung
unabhängig werden lässt. Sondern sie ist darüber hinaus auch
die physiologische Voraussetzung für eine ausdauernde Bewegungsfähigkeit,
indem der Sauerstoff viel besser für die Energiegewinnung genutzt werden
kann. Auch der Flüssigkeitshaushalt wird sehr stabil reguliert. Eine
im Vergleich zu vielen Tieren mittlere Körpergröße unterstützt
die homöostatischen Funktionen, bildet aber keine größere
Belastung für die Bewegung an Land. Außerdem haben wir ein extrem
ausgefeiltes Immunsystem.[e] |
| Desweiteren gibt es Merkmale, die wir mit
den anderen Primaten teilen. Dazu gehört etwa das große Bewegungsumfeld
der Gliedmaßen, besonders der Arme. Unterarm und Hand können
gedreht werden und die Hände sind in nahezu jede Richtung beweglich.
Die einzelnen Finger sind mehr oder weniger unabhängig voneinander
beweglich und die Hand kann greifen. Und alles das steht im Zusammenhang
mit einem ausgesprochen großen und sehr differenzierten Gehirn. |
| Unter den nichtmenschlichen Primaten kommen
spezielle Anpassungen vor, die diese Flexibilität einschränken
können, aber insgesamt gibt es einen Trend in der Evolution der Primaten,
diese Flexibilität zu erweitern. Dies führt nicht nur zu einem
breiteren Spektrum von Bewegungsmöglichkeiten, sondern auch zu neuen
Funktionen, die von der Fortbewegung unabhängig sind. So ist es z.B.
den Menschenaffen möglich, Stöckchen, Steine oder Blätter
als Werkzeuge zu benutzen, was Jane Goodall in den 1960er Jahren als Erste
von freilebenden Schimpansen in Ostafrika berichtete. |
| Dazu kommt auch eine hohe Sensibilität
der Hände für das Ertasten von Objekten. Durch die aufrechte Körperhaltung
– bei den Affen immerhin bereits im Sitzen – werden die Hände
für die verschiedensten Tätigkeiten emanzipiert. |
| All diese Merkmale werden beim Menschen hinsichtlich
Flexibilität, Vielfalt und willentlicher Kontrollierbarkeit erheblich
gesteigert. Durch den vollen aufrechten Gang sind die menschlichen Hände
vollständig von Funktionen der Fortbewegung befreit und haben nahezu
unbegrenzte Möglichkeiten, die weit über diejenigen der anderen
Primaten hinausgehen. Dies wird unterstützt durch eine ausgefeilte
und sehr präzise Koordination zwischen Auge und Hand. Beim Menschen
sind die Gehirnareale für die Wahrnehmung und die Steuerung der Hände
sehr stark entwickelt, und das spiegelt sich wieder in der hohen Dichte
von Nervenendigungen in den Muskeln, den Gelenken und in der Haut der Hände. |
| Bisher verfügbare paläontologische
Funde zeigen, dass die Aufrechte eine sehr alte Errungenschaft des Menschen
ist. Sahelanthropus tschadensis und Ororin tugenensis (ca.
6 – 7 Mio. Jahre alt) hatten bereits die aufrechte Körperhaltung.
Das heißt, dass die vollständige Emanzipation der Hände
bereits entstanden war, bevor die eigentliche Gehirnvergrößerung
einsetzte. |
| Doch die Flexibilität, wie wir sie heute
haben, war bei den frühen Hominiden noch nicht in vollem Ausmaß
entwickelt. Die Hände von Australopithecus afarensis zeigen
anatomische Merkmale für präzisere Tätigkeiten mit gegenüber
den anderen Primaten nur leichten Veränderungen. Die ersten größeren
Änderungen in dieser Hinsicht tauchen mit den frühesten Vertretern
der Gattung Homo auf – parallel zu den ersten Steinartefarkten
des Oldowantyps. Aber die Größe des Rückenmarks blieb im
Vergleich zum Homo sapiens begrenzt, was auf eine noch relativ grobe
motorische Koordination hinweist. Die Hände der Neandertaler glichen
bereits stärker der modernen Hand, sie waren aber noch vorwiegend für
einen kraftvollen Griff ausgebildet. Erst mit dem Erscheinen des modernen
Menschen vor etwa 100.000 Jahren sind manipulative Fähigkeiten nachweisbar,
die den heutigen feinmotorischen Möglichkeiten ähnlich sind. Funde,
die man von Hand- und Armskeletten dieser frühen Sapiensmenschen hat,
sind nicht unterscheidbar von denen heutiger Menschen mit athletischerem
Körperbau. Diese anatomischen Veränderungen sind verbunden mit
vielen technischen Errungenschaften, wie sie archäologisch ab dem Jungpaläolithikum
gefunden wurden. |
| Parallel dazu wurde das Bearbeiten von Steinen
immer feiner und präziser, bis hin zu einer erstaunlichen Kunstfertigkeit
in der Herstellung kleinster Pfeilspitzen und Klingen. Diese Entwicklung
muss begleitet worden sein von einer umfangreichen Verstärkung der
sogenannten Pyramidenbahn, die bei keinem anderen Primaten so prominent
ist wie beim heutigen Menschen. Sie ist eine direkte Nervenbahn von der
Großhirnrinde zu den Nervenzellen der Fingermotorik und damit eine
Grundlage für die präzise Bewegung der menschlichen Hand. |
| Die vielfältige Tätigkeit, die die
menschliche Hand ausführen kann, wird auch möglich durch eine
gewisse Ursprünglichkeit mit geringerer Spezialisierung als sie bei
vielen Säugetieren in den Vordergliedmaßen zu finden ist. Sie
ist also nicht so einseitig festgelegt, wie bei vielen unserer Verwandten. |
| Das Gehen in der Aufrechte versetzte die frühen
Hominiden in die Lage, größere Gebiete innerhalb ihres Lebensraumes
zu erreichen und schließlich auch Afrika zu verlassen. Menschen können
ausdauernd wandern und bewältigen dabei Distanzen von mehr als 30 km
pro Tag. Unter den Säugetieren gibt es zwar viele Beispiele für
größere räumliche Reichweiten. Sie setzen aber immer Spezialisierungen
voraus, die beim Menschen zugunsten einer Gesamtkombination flexibler Handlungsmöglichkeiten
zurückgehalten werden. Der Mensch kam dabei in die Lage, ungünstigen
Witterungsbedingungen und saisonalen Veränderungen durch entsprechende
Techniken zu trotzen. Heute halten wir durch Kleidung und Behausungen eine
tropische Mikroumgebung um uns aufrecht, was uns von schwankenden Umweltgegebenheiten
weitgehend emanzipiert. |
| Eine der entscheidenden Techniken war die
Fähigkeit, ein Feuer zu entfachen und zu kontrollieren. Die ersten
Spuren der Feuernutzung stammen vom Homo erectus, was mit anderen
neuen Fähigkeiten dieser Menschen und mit einer erheblichen Zunahme
des Gehirnvolumens korreliert. Die Beherrschung des Feuers erfordert bereits
ein gewisses vorausschauendes Handeln. Dabei muss das Denken von der aktuellen
Situation entkoppelt werden, was die Möglichkeit des flexiblen Handelns
erweitert. Es muss vorausgesehen werden, dass das Feuer den Brennstoff verbrauchen
wird, dass man rechtzeitig nachlegen und im Voraus Brennstoff bereitlegen
muss. Man muss sich vorstellen können, dass man bei niedergebranntem
Feuer frieren wird, oder allgemeiner, die Bedürfnisse voraussehen,
die man in der Zukunft haben wird, und bereits jetzt handeln. |
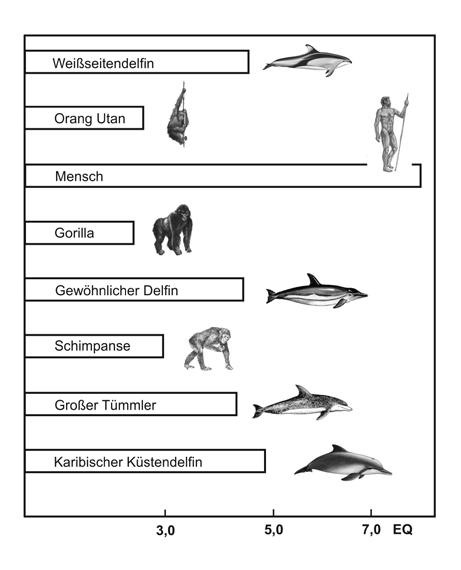
Encephalisationsquotienten (EQ) im Vergleich. Der EQ bestimmt das Verhältnis
zwischen der tatsächlichen relativen Gehirngröße einer Tierart
zur relativen Gehirngröße, wie sie aufgrund der Körpergröße
im Mittel zu erwarten wäre (aus: Marino L (2002): Convergence of complex
cognitive abilities in cetaceans and primates. Brain, Behavior and Evolution
59, 21-32, verändert). |
Kochen schloss nun die Nahrung besser auf,
um ihr mehr Energie entnehmen zu können. Besonders das immer größer
werdende Gehirn benötigte viel Energie. Unser heutiges Gehirn verbraucht
ca. 20 Prozent der Energie, die wir aufnehmen, es ist energetisch also ein
sehr »teures« Organ. |
| Mit seinem großen Gehirn steht der Mensch
unter den Primaten einzig da (nebenstehende Abbildung). Außerdem weisen
vergleichende Daten darauf hin, dass das menschliche Gehirn in der neueren
Evolution eine beträchtliche Reorganisation erfahren hat. Dazu gehört
auch die Differenzierung derjenigen Gehirnareale, die wichtig sind für
die Geschicklichkeit der Hände, der Beine und auch des Sprachapparates,
sowie die Ausbildung der für den Menschen charakteristischen Schichten
der Großhirnrinde. |
| Besonders prominent ist aber die umfangreiche
Ausbildung des Vorderhirns, das nicht auf eine bestimmte Funktion festgelegt
ist, sondern für die Steuerung flexiblen Verhaltens, Neukombinationen
und Planung komplexer Willkürbewegungen zuständig ist. Es ist
sozusagen freigestellt für kreative Verknüpfungen. Damit entstand
auch die Voraussetzung, dass beim Menschen triebhafte oder instinktiv festgelegte
Verhaltensweisen weitgehend unterdrückt und durch selbstgeführte,
autonome Handlungen ersetzt werden können. |
| nach oben |
| 6 Anfänge der kulturellen
Evolution |
| Die erwähnten Steinwerkzeuge liefern
auch Einsichten in die sich entwickelnden mentalen Fähigkeiten früher
Hominiden. Während frühe Werkzeuge vorwiegend nach der Ausgangsform
des Materials beschlagen wurden (frühes Oldowan), erforderten spätere
vorab eine Vorstellung der angestrebten Form und eine gezielte praktische
Umsetzung, um diese zu erreichen. |
| Die Werkzeugnutzung bei Tieren bleibt sehr
einfach, während der Mensch dies zu einer unter den Tieren unerreichten
Vielfalt und Geschicklichkeit entwickelt hat. Schon die Oldowansteinwerkzeuge
deuten auf eine Fähigkeit, Steine zu bearbeiten, wie sie von den heutigen
Schimpansen nicht erlernt werden kann. Neuere Versuche, Schimpansen das
Beschlagen von Steinen beizubringen, sind gescheitert. Später bekamen
Steinwerkzeuge eine solche verfeinerte Formgebung und Retouchierung, dass
sie eindeutig auch ästhetische Aspekte aufweisen.⁸ |
| ⁸ Schad 1985. |
 |
| Artefakte verschiedener Epochen (von links):
Oldowankultur, Acheuléenkultur, Solutréenkultur. Ganz rechts
ist eine Harpune mit zwei Hakenreihen aus dem Magdalénien Frankreichs
abgebildet. Das Aufreten solcher Widerhaken lässt auf einen Bewusstseinsschritt
schließen der die Vorstellung von der Wirkung der Haken im Inneren
einer Beute ohne unmittelbare Wahrnehmung ermöglichte (aus: Johanson
D, Edgar B 2000). |
| Damit gibt es also recht alte Objekte, die
bereits einfache künstlerische Elemente aufweisen. Aber eine noch weitergehende
künstlerische Bedeutung bekommen viele der Dinge, die die Menschen
des Aurignacien hinterlassen haben. Die reichhaltigen Funde in Europa ab
ca. 40.000 vor heute werden mit dem modernen Homo sapiens in Verbindung
gebracht, der sich in dieser Zeit neu aus Afrika ausbreitete. Dazu gehören
beispielsweise Schnitzereien und Ritzungen an Knochen, Elfenbein oder Geweihen.
Jetzt waren jene Freiheitsgrade erreicht, die es ermöglichten, eine
Kunst zu produzieren, die ganz von den Notwendigkeiten des Lebenserhalts
entkoppelt war. |
| Die Kunstprodukte spiegeln die sich neu entwickelnde
Fähigkeit, mit Bildern und abstrakten Formen umzugehen und sich darüber
mitzuteilen. In dieser Zeit entstanden auch jene wunderbaren Höhlenmalereien
Süd-West-Frankreichs und Nordspaniens. Die Bilder, die vorwiegend die
eiszeitliche Tierwelt mit oft sehr charakteristischen Details darstellen,
sind ja im Dunklen der Höhle, entkoppelt von der direkten Wahrnehmung
des gemalten Motivs, entstanden. Es kann angenommen werden, dass diese Höhlenmalerei
ein ganz wesentliches Übungsfeld dafür war, mit Vorstellungen
und inneren Bildern zunehmend autonom umzugehen.⁹ |
| ⁹ Rosslenbroich und Rosslenbroich 2012. |
| Während des Neolithikums erreichten die
Menschen durch Landwirtschaft und Domestikation von Tieren eine weitere
Emanzipation, indem sie vom gegebenen Nahrungsangebot der Umwelt unabhängiger
wurden und einen größeren Teil der Erfüllung ihrer Bedürfnisse
selbst organisieren konnten. Hütten und Häuser dienten zunehmend
dem Schutz vor der Witterung, und die technische Ausstattung machte manche
Einflüsse der Umwelt beherrschbarer. Heute geht diese Emanzipation
vielfach so weit, dass wir in erheblichem Ausmaß den Kontakt zur natürlichen
Umwelt verloren haben und sie zerstören. |
| nach oben |
| 7 Die Jugendzeit |
| Der Mensch hat eine ausnehmend lange Zeit
der Jugendentwicklung, was auch im Zusammenhang mit der Autonomiezunahme
steht:¹° Eine verlängerte Zeit zum Lernen und Ausreifen von
Fähigkeiten erweitert die kulturell und individuell entwickelbaren
Tätigkeiten erheblich gegenüber mehr instinktiv festgelegtem Verhalten,
das beim heutigen Menschen kaum noch eine Rolle spielt. Das lässt sich
auch in der Gehirnreifung feststellen, die unter allen Primaten am längsten
dauert. Dies und die Möglichkeit der Reifung durch Übung und Erfahrung
erweitert die Plastizität der corticalen Funktionen drastisch. |
| ¹° Kipp 1991. |
| Untersuchungen zeigten, dass der spezialisiertere
Neandertaler eine beschleunigte Körperentwicklung gegenüber anderen
Frühmenschen und dem heutigen H. sapiens hatte, so dass er früher
erwachsen war.¹¹ Die höhere Flexibilität des H. sapiens
mit der Ausbildung einer besonders diffenzierten Kultur basiert also gerade
auf der verlangsamten Entwicklung im Jugendalter. Daraus lässt sich
leicht ableiten, dass es für heutige junge Menschen von entscheidender
Bedeutung ist, für ihre individuelle Entwicklung genügend Zeit
zu haben. Alle Versuche, Ausbildung und Erziehung zu beschleunigen, wird
ihre kreativen Möglichkeiten reduzieren. Gerade die Schule sollte alles
daran setzen, dieses Freiheitspotenzial junger Menschen zu nutzen, sein
Ergreifen zu fördern und die dafür benötigte Zeit zu schützen.
Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass dies zum Wertvollsten gehört,
was uns die Evolution mitgegeben hat. |
| ¹¹ Ziegler 2004, Ramirez Rozzi &
Bermudez de Castro 2004, Smith et al. 2010. |
| Hier wird nun auch deutlich, dass das Spiel
elementar zu unserem Menschsein gehört. Die Anklänge daran gibt
es, wie oben ausgeführt, bereits bei Säugetieren und Vögeln.
Aber bei keinem anderen Lebewesen ist das Spiel so bedeutend wie beim Menschen,
nicht nur in Kindheit und Jugend. Spiele machen einen umfangreichen Teil
der Kultur aus. Vom Schach über Fußball, Reiten oder Skifahren
bis hin zu den Olympischen Spielen kultivieren wir unsere Emanzipation.
Im Sport oder auch in der bewundernswerten Zirkusakrobatik verbindet sich
das Spiel mit der Kultivierung der Bewegungsautonomie. |
| Im Spiel sind wir kreativ. Das wusste auch
Friedrich Schiller und formulierte in den Briefen über die ästhetische
Erziehung des Menschen (15. Brief): »…der Mensch spielt nur,
wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch,
wo er spielt.«¹² |
| ¹² Zitiert nach Matuschek 2009. |
| Der niederländische Kulturhistoriker
Johan Huizinga (2009) entwickelte sogar ein Erklärungsmodell, nach
dem der Mensch seine Fähigkeiten besonders über das Spiel entwickelte
(Homo ludens = der spielende Mensch). Er entdecke im Spiel seine individuellen
Eigenschaften und entwickle sich anhand der dabei gemachten Erfahrungen
zum dem, was er ist. Spielen setze dabei Handlungsfreiheit und eigenes Denken
voraus. |
| Die Natur, wie sie uns aus der Evolution hervorgehen
ließ, formt also die Grundlage für die hochgradig flexiblen Möglichkeiten
des kulturschaffenden Menschen. Das Ergebnis unserer organischen Evolution
ist ein hohes Maß an Flexibilität auf verschiedensten Ebenen
und bildet damit die physiologischen Voraussetzungen für die Möglichkeit
der Freiheit. Der Mensch ist keineswegs determiniert durch seine Natur.
Sondern er ist schon von Natur aus mit umfangreichen Freiheitsmöglichkeiten
ausgestattet, die dann kulturell ergriffen und weiter geführt werden
können – weit über das hinaus, was die Natur lediglich der
Möglichkeit nach anbietet. Die biologische Geschichte der Menschheit
muss erzählt werden in den Begriffen von Autonomie, zunehmender Flexibilität
und Freiheitsgraden. |
| Immer handelt es sich aber nur um eine relative
Autonomie, denn gleichzeitig sind wir an viele Bedingungen des Organismus
und der Umwelt gebunden. Wir benötigen Nahrung, Schlaf, Erholung, eine
gesunde soziale Umwelt und vieles mehr. Auch unser Handeln ist an organische
Bedingungen geknüpft, und vielfach scheinen archaische und wenig reflektierte
Auslöser von Verhaltensweisen eine Rolle zu spielen. Wenn man nur diese
Seite unserer Natur betrachtet, finden Theorien wie etwa die eingangs erwähnte
evolutionäre Psychologie durchaus Argumente, und die eine oder andere
Interpretation aus dieser Perspektive mag ja zutreffen. Aber man kann nicht
das Handeln des Menschen einseitig auf diese Perspektive beschränken. |
| Gesundheitliche Einschränkungen können
unsere Möglichkeitenmehr oder weniger stark begrenzen. Bedeutet Gesundheit
nicht generell, eine umfangreiche Autonomie zu haben, sowohl körperlich
als auch seelisch-geistig? |
| In diesem Sinne ist unsere Natur nicht determinierend,
sondern ermöglichend. Damit löst sich der am Anfang dieses Beitrags
beschriebene Gegensatz zwischen philosophischer und naturwissenschaftlicher
Auffassung auf. |
| nach oben |
| 8 Philosophie der Freiheit |
| In dem Buch Die Philosophie der Freiheit
entwickelt Rudolf Steiner (1918), dass dem Menschen eine grundlegende Freiheitsfähigkeit
zukomme. Diese Freiheit sei allerdings nicht in allen menschlichen Handlungen
gegeben, sondern nur dort, wo der Mensch zu einem wirklich individuellen,
unabhängigen Urteil komme. Der freie Geist handle nach seinen eigenen
Intuitionen, die er aus dem Ganzen seiner Ideenwelt durch das Denken auswählt.
Diese Auffassung bezeichnet er als den »Ethischen Individualismus«.
Im 12. Kapitel formuliert er: »Der ethische Individualismus steht
… nicht im Gegensatz zu einer recht verstandenen Entwickelungstheorie,
sondern folgt direkt aus ihr. Der Haeckelsche Stammbaum von den Urtieren
bis hinauf zum Menschen als organisches Wesen müßte sich ohne
Unterbrechung der natürlichen Gesetzlichkeit und ohne eine Durchbrechung
der einheitlichen Entwickelung heraufverfolgen lassen bis zu dem Individuum
als einem im bestimmten Sinne sittlichen Wesen … Der ethische Individualismus
ist … die Krönung des Gebäudes, das Darwin und Haeckel für
die Naturwissenschaft erstrebt haben. Es ist vergeistigte Entwickelungslehre
auf das sittliche Leben übertragen … Von einer sich selbst verstehenden
Naturwissenschaft hat der ethische Individualismus nichts zu fürchten:
die Beobachtung ergibt als Charakteristikum der vollkommenen Form des menschlichen
Handelns die Freiheit« (S. 198-201). |
| Mit dem oben beschriebenen Konzept der Autonomieentstehung
in der Evolution ist diese Annahme, dass sich der »Haeckelsche Stammbaum«,
wie Steiner sich in seiner Zeit ausdrückte, bis hin zum Menschen als
freiheitsfähigem Wesen verfolgen lassen müsste, bestätigt
und in Einzelbelegen ausgeführt. |
| nach oben |
| 9 Noch ein Blick auf die Tiere |
| Ich will noch einmal auf die Tiere zurückkommen.
Es ist großartig, zu erleben, wie dieses Panorama der Autonomie bei
ihnen in verschiedenster Weise veranlagt ist. Durch die beschriebenen Einsichten
habe ich eine neue Perspektive auf viele Phänomene der Natur gewonnen.
Spielenden Tieren zuzusehen ist nicht nur eine nette Beobachtung, sondern
macht erlebbar, wie die Natur beginnt über sich selbst hinauszuwachsen.
Eine jagende Katze mit ihren dynamischen, eleganten, präzisen Bewegungen
zu beobachten, die Moschusochsen zu sehen, wie sie mit ihrer immensen Stoffwechselautonomie
dem rauhen Klima auf dem Dovrefjell in Norwegen trotzen, oder den Flugmanövern
der Küstenseeschwalbe zuzusehen, gibt vor diesem Hintergrund immer
neue Einblicke in das, was die Natur zu erzählen hat. |
| Wenn die Raubvögel sich am frühen
Morgen ohne einen einzigen Flügelschlag von der Thermik in die Höhe
tragen lassen, zelebrieren sie ihre Bewegungsautonomie im Flug und spielen
mit den Strömungen, als ob sie uns sagen wollten, worin für sie
der Inbegriff der Freiheit liegt. |
| Walter Streffer öffnete meine Ohren für
die enorme musikalische Flexibilität, die die Meistersinger unter unseren
Vögeln hervorbringen können. Zu erleben wie ein Pferd einem geschulten
und sensiblen Reiter seine Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung
stellt und dabei seine Schönheit und Eleganz präsentiert; die
engagierte Mitarbeit eines Hundes zu beobachten, der einen Blinden führt;
oder die ausgelassene Spiel- und Bewegungsfreude von Delfinen zu sehen:
All solche Erlebnisse bekommen eine neue Dimension. |
| Vermittels der Empathie [f]
können wir das emotionale Leben vieler Tiere erfahren.¹³
Freude, Zuneigung, Wohlbefinden, Erregung und Kummer sind Fähigkeiten
hoch autonomer Tiere. Ich teile angesichts dieser Einblicke absolut Marc
Bekoffs (2007) eindringlichen Appell für eine grundlegende Änderung
im Umgang mit den Tieren in der industriellen Landwirtschaft und in wissenschaftlichen
Experimenten. |
¹³ Einigen modernen Verhaltensforschern
gelingt es zunehmend, dies auch in wissenschaftliche Beschreibungen
aufzunehmen: Marc Bekoff (2007), Frans de Waal (2011), Lawick-Goodall J
van (1971). |
| Das Verhalten der Tiere fasziniert Menschen
jeden Alters, und es gibt vieles, was uns mit ihnen verbindet. Wir nehmen
einen Teil von uns selbst in ihnen wahr. Bekoff schreibt: »In many
ways ›we are them‹ and ›they are us‹.« Der Verhaltensforscher
Günter Tembrock, der im Januar 2011 im Alter von 92 Jahren verstarb,
sagte es noch treffender: »Es steckt das ganze Tier im Menschen, aber
nicht der gesamte Mensch im Tier«.¹⁴ |
| ¹⁴ Hartmut Wewetzer: Günter
Tembrock. Ein Ohr für Tiere, in: Tagespiegel 27.1.2011. |
| Auch der Philosoph Hans Jonas (1973) verbindet
den Ursprung der Freiheit mit der gesamten Tierwelt und führt sie an
deren früheste Ursprünge zurück: |
| »In der lauten Entrüstung über
den Schimpf, den die Lehre von der tierischen Abstammung der metaphysischen
Würde des Menschen angetan habe, wurde übersehen, dass nach dem
gleichen Prinzip dem Gesamtreich des Lebens etwas von seiner Würde
zurückgegeben wurde. Ist der Mensch mit den Tieren verwandt, dann sind
auch die Tiere mit dem Menschen verwandt und in Graden Träger jener
Innerlichkeit, deren sich der Mensch, der vorgeschrittenste ihrer Gattung,
in sich selbst bewußt ist … An welchem Punkte dann in der enormen
Spanne dieser Reihe läßt sich mit gutem Grund ein Strich ziehen,
mit einer ›Null‹ an Innerlichkeit auf der uns abgekehrten Seite
und der beginnenden ›Eins‹ auf der uns zugekehrten? Wo anders
als am Anfang des Lebens kann der Anfang der Innerlichkeit angesetzt werden?«
(Jonas 1992, S. 17). |
| nach oben |
| Literatur |
| Bauer J (2008): Das kooperative Gen. Abschied
vom Darwinismus, Hamburg |
| Bekoff M (2007): The emotional lives of
animals, Novato California |
| Burghardt G (2005): The Genesis of Animal
Play. Testing the Limits, Cambridge, MA |
| Damasio A (2010): Self comes to mind. Constructing
the conscious brain, London |
| Eibl-Eibesfeldt
I (1999): Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung, München,
Zürich |
| Falkenburg B (2012): Mythos Determinismus.
Wieviel erklärt uns die Hirnforschung?, Heidelberg. |
| Fuchs T (2009): Das Gehirn – ein Beziehungsorgan.
Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption, Stuttgart |
| Geyer C (Hrsg.) (2004): Hirnforschung und
Willensfreiheit, Frankfurt |
| Heilinger JC (Hrsg.) (2007): Naturgeschichte
der Freiheit, Berlin, New York |
| Holdrege C (1999): Der
vergessene Kontext. Entwurf einer ganzheitlichen Genetik, Stuttgart |
| Huizinga
J (2009): Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Hamburg |
| Jablonka E, Lamb MJ (2005): Evolution in
Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation
in the History of Life, Cambridge MA |
| Janich P (Hrsg.) (2008): Naturalismus und
Menschenbild, Hamburg |
| Johanson D, Edgar B (2000): Lucy und ihre
Kinder, Heidelberg |
| Jonas
H (1973): Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen
Biologie, Göttingen |
| Jonas H (1992): Philosophische Untersuchungen
und metaphysische Vermutungen, Frankfurt a.M., Leipzig. |
| Kipp
FA (1980, 21991): Die Evolution des Menschen im Hinblick auf seine lange
Jugendzeit, Stuttgart |
| Lawick-Goodall
J van (1971): Wilde Schimpansen. 10 Jahre Verhaltensforschung am Gombe-Strom,
Hamburg |
| Lewontin
R (2002): Die Dreifachhelix. Gen, Organismus und Umwelt, Heidelberg |
| Lewontin R, Rose S, Kamin LJ (1988): Die
Gene sind es nicht. Biologie, Ideologie und menschliche Natur, München |
| Lewontin RC (1991): Biology as Ideology,
New York |
| Matuschek S (Hrsg.) (2009): Friedrich Schiller:
Über die ästhetische Erziehungdes Menschen in einer Reihe von
Briefen, Frankfurt |
| Neuweiler G (2008): Und wir sind es doch
– die Krone der Evolution, Berlin |
| Nida-Rümelin
J (2005): Über menschliche Freiheit, Stuttgart |
| Ramirez Rozzi FV, Bermudez de Castro JM (2004):
Surprisingly rapid growth in Neanderthals, in: Nature 428,
936-939 |
| Rosslenbroich B (2002): Geschichte und
Problem des Höherentwicklungsbegriffs, in: Tycho de Brahe Jahrbuch,
7-75 |
| Rosslenbroich B (2006a): Zur Autonomieentstehung
in der Evolution – Eine Übersicht, in: Tycho de Brahe Jahrbuch,
157 - 200 |
| Rosslenbroich B (2006b): The notion of
progress in evolutionary biology - the unresolved problem and an empirical
suggestion, in: Biology and Philosophy 21, 41-70 |
| Rosslenbroich B (2007): Autonomiezunahme
als Modus der Makroevolution, Nümbrecht |
| Rosslenbroich B (2009): The theory of increasing
autonomy in evolution: a proposal for understanding macroevolutionary innovations,
in: Biology and Philosophy 24, 623-644 |
| Rosslenbroich B (2012): On the origin of
autonomy – a new look at the major transitions in evolution (in
Vorbereitung) |
| Rosslenbroich M, Rosslenbroich B (2012): Die
französich-spanische Höhlenkunst – Wiege der Autonomie des
menschlichen Bewusstseins, in: die Drei 11/2012 (in Vorbereitung) |
| Roth G (2001): Fühlen, Denken, Handeln.
Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, Frankfurt a. M. |
| Roth G (2003): Aus Sicht des Gehirns,
Frankfurt a. M. |
| Schad
W (1985): Die frühen Erfahrungen am Stein der Erde. Von der Kunst
des späten Atlantiers, in: die Drei 11/1985, 795-825 |
| Scheurle HJ (2007): Hirnfunktion und Willensfreiheit.
Eine minimalistische Hirntheorie. Perspektiven, in: Matthiessen P (Hrsg.):
Schriften zur Pluralität in der Medizin, Frankfurt |
| Singer
W (2003): Ein neues Menschenbild? Gespräche über Hirnforschung,
Frankfurt a. M. |
| Smith TM, Tafforeau P, Reid DJ, Pouech J,
Lazzari V, Zermeno JP, Guatelli-Steinberg D, Olejniczak AJ, Hoffman A, Radovèiæ
J, Makaremi M, Toussaint M, Stringer C, Hublin JJ (2010): Dental evidence
for ontogenetic differences between modern humans and Neanderthals,
in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States
of America 107(49), 20923-20928, DOI: 10.1073/pnas.1010906107 |
| Spork P (2009): Der zweite Code. Epigenetik
- oder wie wir unser Erbgut steuern können, Hamburg |
| Steiner R (1918): Die
Philosophie der Freiheit (GA 4), Ausgabe Dornach 1978 |
| Streffer
W (2009): Klangsphären. Motive der Autonomie im Gesang der Vögel,
Stuttgart |
| Strohman R (2001): Was kommt nach dem genetischen
Determinismus?, in: Laborjournal 6, 24-26 |
| Strohman R (2002): Maneuvering in the complex
path from genotype to phenotype, in: Science 296, 701-703 |
| Strohman RC (1998): Eine Kuhn‘sche
Revolution in der Biologie steht ins Haus. Arbeitsmaterialien zur Technologiefolgenabschätzung
und -bewertung der modernen Biotechnologie, in: Universität
Hamburg No. 9 |
| Thompson E (2007): Mind in life. Biology,
phenomenology, and the sciences of mind, Cambridge/MA, London |
| Waal
F de (2011): Das Prinzip Empathie. Was wir von der Natur für eine
bessere Gesellschaft lernen können, München. |
| Wieser W (1998): Die Erfindung der Individualität
oder Die zwei Gesichter der Evolution, Heidelberg, Berlin |
| Ziegler R (2004): Beschleunigtes Wachstum
bei Neandertalern, in: Naturwissenschaftliche Rundschau 57(9),
510-511 |
| |
| in »die
Drei« 10/2012; S.15-34 |
| Unsere Anmerkungen |
| a] vgl. Mbl-B.26 |
| b] So stellt auch in der Geisteswissenschaft
die Interpretation (also das In-Begriffe-Giessen und damit In-einen-Kontext-Stellen)
einer Imagination, Inspiration
oder Intuition die eigentliche
Erkenntnisklippe dar. |
| c] zB. Kakadus |
| d] Dieses allumfassend angelegte
Schauspiel der Entwicklung kann als Suche des schaffenden Wesens nach Erkenntnis
seiner selbst aufgefasst werden. |
| e] Das Immunsystem kann als
mittelbarer Ausdruck des ICh im lebendigen physischen Leib betrachtet werden. |
| f] Die Fähigkeit innerlich
mitzuleiden (Empathie) setzt den Menschen überhaupt erst in die Lage,
ein Phänomen erlebend zu begreifen. Dies erfordert allerdings ein ausgewogenes
und dadurch neutrales Mitwirken von Sym- und Antipathie. |
| nach oben oder zur Übersicht |
© for Unsere Anmerkungen 2012 by DMGG
revid.201505 |
| https://wfgw.diemorgengab.at/WfGWmblB35.htm |